Unterhalt des betreuenden Elternteils
aktualisiert am 31.01.24 von Jennifer Reh Familienrecht, Georg-August-Universität Göttingen

Was erwartet Sie auf dieser Seite?
Hier finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen:
- Was ist der Betreuungsunterhalt und wem steht dieser zu?
- Wie lange besteht ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt?
- In welcher Höhe ist Betreuungsunterhalt zu zahlen?
- Wie wirkt sich eine neue Partnerschaft des hauptbetreuenden Elternteils aus?
- Besteht auch bei einem Wechselmodell ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt?
Sie erhalten hier einen ersten Überblick über die Rechtslage. Dieser kann jedoch eine anwaltliche Beratung im konkreten Einzelfall nicht ersetzen.
/ Alle Informationen auf dieser Seite gelten gleichermaßen für die eingetragene Lebenspartnerschaft.
Was ist der Betreuungsunterhalt und wem steht dieser zu?
Zweck des Betreuungsunterhalts
Der Betreuungsunterhalt soll eine gerechte Lastenverteilung zwischen den getrenntlebenden Eltern bewirken, für den Fall, dass der hauptbetreuende Elternteil wegen der Betreuung des gemeinsamen Kindes nicht oder nur eingeschränkt erwerbstätig sein kann, während der andere Elternteil seinen Beruf in der Regel ohne Einschränkungen ausüben kann. Der Unterhalt ist dabei monatlich im Voraus zu zahlen.
Das Gesetz differenziert zwischen dem Betreuungsunterhalt nach einer Scheidung (§ 1570 BGB ) und dem Betreuungsunterhalt bei nicht miteinander verheirateten Eltern (§ 1615l Absatz 2 bis 4 BGB ). Bei den Voraussetzungen und den Rechtsfolgen der beiden Unterhaltsansprüche gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die im Folgenden dargestellt werden. Der Betreuungsunterhalt nach einer Scheidung ist eine Form des nachehelichen Unterhalts, sodass für diesen auch die allgemeinen Ausführungen zum nachehelichen Unterhalt gelten. Der nacheheliche Unterhalt wird auf einer eigenen Seite ausführlich behandelt.
Verhältnis zwischen Betreuungs- und Kindesunterhalt
Der Betreuungsunterhalt besteht neben dem Anspruch des Kindes auf Kindesunterhalt. Mit dem Kindesunterhalt soll die Versorgung des Kindes sichergestellt werden, während mit dem Betreuungsunterhalt der eigene Lebensbedarf des hauptbetreuenden Elternteils gedeckt wird.
Voraussetzungen des Betreuungsunterhalts
Ein Anspruch des hauptbetreuenden Elternteils auf Betreuungsunterhalt besteht, wenn…
- ein gemeinsames Kind betreuungsbedürftig ist,
- dieses Kind tatsächlich betreut wird und der hauptbetreuende Elternteil deshalb nicht (voll) erwerbstätig ist
Bei Eltern, die miteinander verheiratet waren, besteht der Anspruch erst ab der Scheidung. Für den Zeitraum zwischen Trennung und Scheidung kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch auf Trennungsunterhalt bestehen.
Der Betreuungsunterhalt wird nur für die Pflege und Erziehung gemeinsamer Kinder gewährt.
Dazu zählen:
- Kinder, die in der Ehe geboren wurden
- Kinder, bei denen die Vaterschaft anerkannt wurde
- Kinder, bei denen die Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde
- Kinder, die gemeinsam adoptiert wurden
Betreuungsunterhalt für die Betreuung von Stiefkindern kommt nicht in Betracht. Hier kann aber im Einzelfall ein nachehelicher Unterhaltsanspruch aus Billigkeitsgründen bestehen. Anders ist dies, wenn das Stiefkind vom hauptbetreuenden Elternteil adoptiert wurde (sogenannte Stiefkindadoption). Dann handelt es sich im rechtlichen Sinne um ein gemeinsames Kind, für dessen Pflege und Erziehung Betreuungsunterhalt verlangt werden kann.
Wie lange besteht ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt?
Grundsatz: Betreuungsunterhalt für die ersten drei Jahre nach der Geburt des Kindes
In den ersten drei Lebensjahre gilt das gemeinsame Kind nach dem Gesetz stets als betreuungsbedürftig. Während der ersten drei Lebensjahren des Kindes ist der hauptbetreuende Elternteil daher nicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verpflichtet, sondern kann sich ganz der Erziehung und Pflege des gemeinsamen Kindes widmen und für diese Zeitspanne einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt geltend machen. Arbeitet der hauptbetreuende Elternteil trotzdem und gibt das Kind in die Kita oder zu einer Tagespflegeperson, hat dies in der Regel keine Auswirkungen auf den Betreuungsunterhalt. Der Unterhaltsanspruch besteht auch in diesem Fall für die ersten drei Lebensjahre des Kindes grundsätzlich in voller Höhe (sogenannter Basisunterhalt).
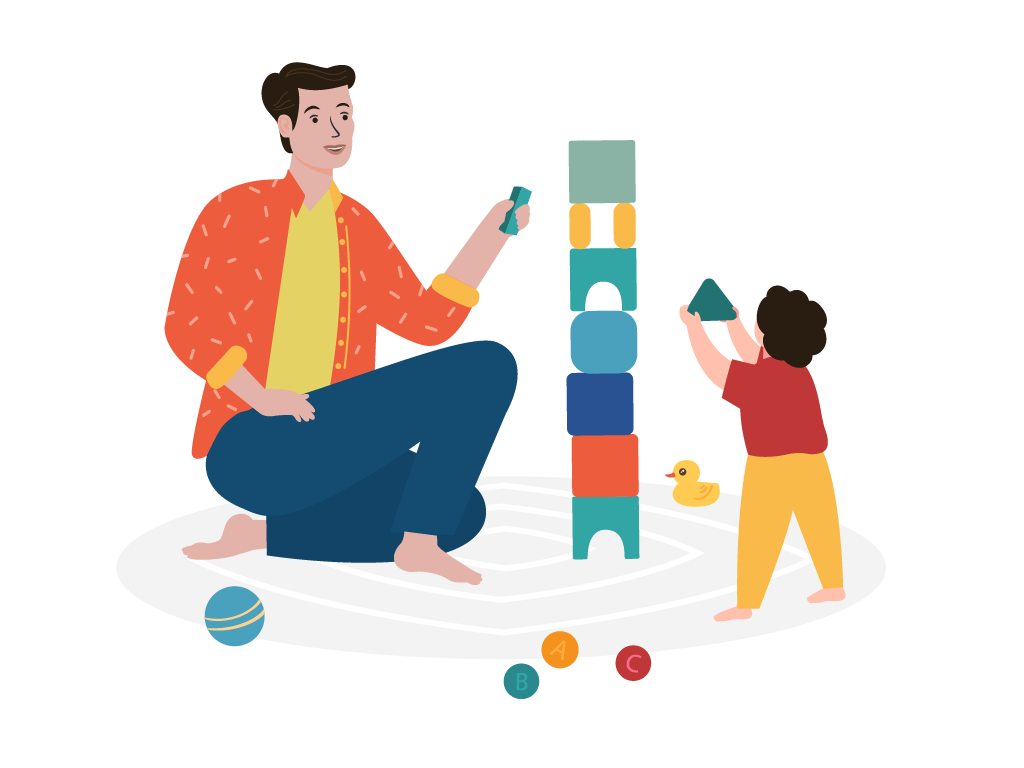
Betreuungsunterhalt für Kinder unter drei Jahren
Ausnahme: Betreuungsunterhalt über den dritten Kindergeburtstag hinaus
Bei Kindern, die älter als drei Jahre sind, hat die Betreuung in einer Betreuungseinrichtung grundsätzlich Vorrang vor der persönlichen Betreuung durch einen Elternteil. Da ab dem dritten Geburtstag des Kindes ein Anspruch auf einen Kindergartenplatz besteht (§ 24 Absatz 3 SGB VIII
), ist der hauptbetreuende Elternteil grundsätzlich dazu angehalten, das Kind ab diesem Alter in eine Kita oder andere Betreuungseinrichtung zu geben und einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, um sich selbst finanziell zu versorgen. Ausnahmsweise kann Betreuungsunterhalt über das dritte Lebensjahr des Kindes hinaus verlangt werden, soweit dies der Billigkeit entspricht. Dies kann aufgrund der individuellen Betreuungsbedürftigkeit des Kindes (sogenannte kindbezogene Gründe) oder aus elternbezogenen Gründen der Fall sein. Bei volljährigen Kindern kommt ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt nur selten in Betracht.
Kindbezogene Gründe
Ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt bei Kindern nach dem dritten Lebensjahr kommt in Betracht, wenn das Kind in besonderem Maße betreuungsbedürftig ist. Die Betreuungsbedürftigkeit ist für jedes Kind individuell zu bestimmen. Maßgeblich sind der Gesundheitszustand, Entwicklungsstand sowie die persönlichen Begabungen und Neigungen. Eine besondere Betreuungsbedürftigkeit kann auch noch nach Eintritt der Volljährigkeit bestehen, wenn das Kind pflegebedürftig ist.
Entscheidend ist, ob die persönliche Betreuung durch einen Elternteil notwendig ist oder durch Kindergarten, Schule und organisierte Nachmittagsbetreuung genauso gewährleistet werden kann.
Eine besondere Betreuungsbedürftigkeit besteht beispielsweise, wenn …
das Kind eine Behinderung hat oder chronisch krank ist
Entwicklungsstörungen vorliegen
ein besonderer Förderungsbedarf besteht
außerschulische Aktivitäten des Kindes Fahrdienste erforderlich machen
Elternbezogene Gründe
Auch elternbezogene Gründe können dazu führen, dass Betreuungsunterhalt für die Betreuung älterer Kinder zu gewähren ist. Elternbezogen sind diese Gründe, weil sie sich auf die Elternbeziehung oder die Person des hauptbetreuenden Elternteils beziehen. Die Gründe müssen in der Regel zum Zeitpunkt der Trennung oder zum dritten Geburtstag des Kindes vorliegen, damit (weiterhin) ein Unterhaltsanspruch besteht. Zwei wichtige Fälle sind zu unterscheiden:
- Vertrauen auf gemeinsame Gestaltung von Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit während des familiären Zusammenlebens
Dem hauptbetreuenden Elternteil kann für eine Übergangszeit nach der Trennung bzw. Scheidung ein Unterhaltsanspruch zugestanden werden, um eine angemessene Arbeitsstelle zu finden. Bei der Festlegung der Anspruchsdauer sind Ausbildungsstand, Dauer der Lebensgemeinschaft und Anzahl der Kinder zu berücksichtigen. Dieser Anspruch schützt das Vertrauen in die gelebte Rollenverteilung vor der Trennung, wenn diese auf einem gemeinsamen Lebensentwurf beruhte. Bei verheirateten Eltern wird stets angenommen, dass ein gemeinsamer Lebensentwurf vorliegt, während bei nicht miteinander verheirateten Eltern die gemeinsame Lebensplanung und ein darauf begründetes Vertrauen vom hauptbetreuenden Elternteil nachgewiesen werden müssen. - Unzumutbare Doppelbelastung des hauptbetreuenden Elternteils
Trotz Fremdbetreuung des Kindes kann der hauptbetreuende Elternteil im Einzelfall einer unzumutbaren Doppelbelastung durch verbleibende Betreuungsleistungen in den Morgen- und Abendstunden, Haushaltsführung und Vollzeittätigkeit ausgesetzt sein. Der Betreuungsaufwand ist dabei individuell vom Alter und Entwicklungsstand sowie von der Anzahl der Kinder abhängig. Besteht eine solche unzumutbare Doppelbelastung, kann vom hauptbetreuenden Elternteil regelmäßig nur eine reduzierte Erwerbstätigkeit erwartet werden. In diesen Fällen besteht ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt in der Höhe, in der der Lebensbedarf durch eigene Erwerbstätigkeit nicht gedeckt werden kann.
Der Anspruch auf Unterhalt wegen der Betreuung älterer Kind kann jederzeit neu entstehen (z. B. bei Erkrankung des Kindes), wieder aufleben (z. B. Ganztagsfremdbetreuung nicht mehr möglich), aber auch entfallen (z. B. Übergang des Kindes auf weiterführende Schule).
Beispiele aus der Rechtsprechung, in denen eine Verlängerung des Betreuungsunterhalts über das dritte Lebensjahr des Kindes hinaus bejaht wurde, finden Sie hier:
In welcher Höhe ist Betreuungsunterhalt zu zahlen?
Berechnungsschritte für den Betreuungsunterhalt
Bei der Berechnung des Betreuungsunterhalts ist zwischen dem Betreuungsunterhalt nach einer Scheidung und dem Betreuungsunterhalt bei nicht miteinander verheirateten Eltern zu unterscheiden.
Betreuungsunterhalt nach einer Scheidung
Erläuterungen zur Höhe des Betreuungsunterhalts nach einer Scheidung finden Sie beim nachehelichen Unterhalt.
Betreuungsunterhalt bei nicht miteinander verheirateten Eltern
Bei der Berechnung des Betreuungsunterhalts nicht miteinander verheirateter Eltern ergeben sich einige Abweichungen zum Betreuungsunterhalt nach einer Scheidung. Die folgenden Ausführungen bieten eine erste Orientierung zur Unterhaltsberechnung in drei Schritten.
Praxis-Hinweis:
Unterhaltsvereinbarung treffen und titulieren lassen!
Statt den Betreuungsunterhalt in einem gerichtlichen Verfahren festzusetzen, können Sie die gesetzliche Unterhaltspflicht auch mit anwaltlicher Hilfe in einer Unterhaltsvereinbarung konkretisieren.
Die Unterhaltsvereinbarung können Sie kostenlos beim Jugendamt titulieren lassen (§ 59 Absatz 1 Nr. 4 SGB VIII
). Dadurch wird die Vereinbarung auch zwangsweise durchsetzbar.
1. Bestimmung des Unterhaltsbedarfs nach der Lebensstellung des unterhaltsberechtigten Elternteils
Die Bedarfsbestimmung erfolgt nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des hauptbetreuenden Elternteils. Maßgeblich ist das Einkommen, welches dieser ohne die Geburt und die Betreuung des gemeinsamen Kindes erzielt hätte. Es ist somit das vorgeburtliche Einkommen oder die hypothetische Einkommensentwicklung ohne die Geburt zugrunde zu legen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils sind nicht relevant. Als Mindestbetrag kann das Existenzminimum in Höhe von 1.200 € verlangt werden (Stand: 2024).
Maßgebliches Einkommen des Unterhaltsberechtigten
| Einkünfte vor der Geburt | Lebensbedarf während Kindesbetreuung |
|---|---|
| Einkommen aus Erwerbstätigkeit | in Höhe des erzielten Einkommens vor der Geburt |
| noch im Studium oder in der Ausbildung | in Höhe des hypothetischen Einkommens nach dem Abschluss |
| Bezug von Sozialleistungen | in Höhe der Sozialleistungen |
| keine Einkünfte | in Höhe des Existenzminimums (1.200 €, Stand: 2024) |
2. Berücksichtigung der Bedürftigkeit des unterhaltsberechtigten Elternteils
Der hauptbetreuende Elternteil kann nur Unterhalt verlangen, soweit er seinen Unterhaltsbedarf nicht selbst decken kann. Das bereinigte Nettoeinkommen des unterhaltsberechtigten Elternteils ist daher auf seinen Unterhaltsbedarf anzurechnen. Hier finden Sie eine Anleitung zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens:
Keine Anrechnung von überobligatorischen Einkünften
Beachten Sie jedoch, dass der unterhaltsberechtigte Elternteil in den ersten drei Lebensjahren des Kindes nicht verpflichtet ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und deshalb daraus erwirtschaftetes Einkommen in der Regel nicht angerechnet wird.
3. Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils
Der unterhaltspflichtige Elternteil muss leistungsfähig sein. Das bedeutet, dass er den Unterhaltsanspruch ohne Gefährdung seines eigenen angemessenen Lebensbedarfs erfüllen können muss. Ihm muss diesbezüglich ein angemessener Selbstbehalt in Höhe von 1.600 € bei Erwerbstätigkeit, andernfalls in Höhe von 1.475 € verbleiben (Stand: 2024). Es ist stets zu prüfen, ob dem Unterhaltspflichtigen nach Abzug des zu zahlenden Unterhalts von seinem bereinigten Nettoeinkommen ein Betrag verbleibt, der über dem angemessenen Selbstbehalt liegt. Ansonsten ist der Unterhalt nur bis zur Höhe des Selbstbehalts zu zahlen.
Aber auch dann, wenn der angemessene Selbstbehalt gewährleistet ist, soll der Unterhaltspflichtige nicht mehr als 45 % seines bereinigten Nettoeinkommens zahlen müssen. Hier finden Sie eine Anleitung zur Ermittlung des bereinigten Nettoeinkommens:
Behandlung sogenannter Mangelfälle
Ist der unterhaltspflichtige Elternteil mehreren Personen gegenüber zum Unterhalt verpflichtet und reicht das Einkommen nicht aus, um alle Unterhaltsansprüche zu erfüllen, liegt ein sogenannter Mangelfall vor. Welcher Unterhaltsanspruch dann vorrangig zu erfüllen ist, erfahren Sie hier:
Manchmal reicht das Geld nicht für alle Unterhaltszahlungen aus
Wie wirkt sich eine neue Partnerschaft des hauptbetreuenden Elternteils aus?
Lebt der hauptbetreuende Elternteil in einer neuen Partnerschaft, kann der Anspruch auf Betreuungsunterhalt unter Umständen beschränkt werden oder vollständig entfallen.
Beschränkung des Anspruchs bei neuer Partnerschaft
Lebt der hauptbetreuende Elternteil mit einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner unverheiratet in einer verfestigten Lebensgemeinschaft, hat dies in den meisten Fällen keine Auswirkung auf den Betreuungsunterhalt. Die Interessen des gemeinsamen Kindes sind vorrangig.
Es kann aber ein fiktives Einkommen angesetzt werden, wenn der hauptbetreuende Elternteil in der neuen Partnerschaft den Haushalt führt und deswegen keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Dieses fiktive Einkommen wird dann auf den Unterhaltsanspruch angerechnet, sodass sich die Höhe des Betreuungsunterhalts entsprechend reduziert.

Eine neue Partnerschaft kann sich auf den Betreuungsunterhalt auswirken
Erlöschen des Anspruchs bei Heirat
Der Anspruch auf Betreuungsunterhalt erlischt vollständig, wenn der hauptbetreuende Elternteil eine neue Partnerin oder einen neuen Partner heiratet. Der Unterhaltsanspruch kann jedoch wiederaufleben, wenn die neu eingegangene Ehe geschieden wird und nach dieser Scheidung das gemeinsame Kind weiterhin betreuungsbedürftig ist.
Besteht auch bei einem Wechselmodell ein Anspruch auf Betreuungsunterhalt?
Gesetzliche Regelung geht von Residenzmodell aus
Die gesetzlichen Regelungen zum Betreuungsunterhalt sind auf das sogenannte Residenzmodell zugeschnitten, bei dem das Kind ganz überwiegend von einem Elternteil betreut wird und mit dem anderen Elternteil regelmäßig Umgang hat.
Teilen sich die Eltern nach der Trennung die Betreuung des gemeinsamen Kindes (sogenannte geteilte Betreuung bzw.
Wechselmodell
), stellt sich die Frage nach den Auswirkungen auf den Betreuungsunterhalt.
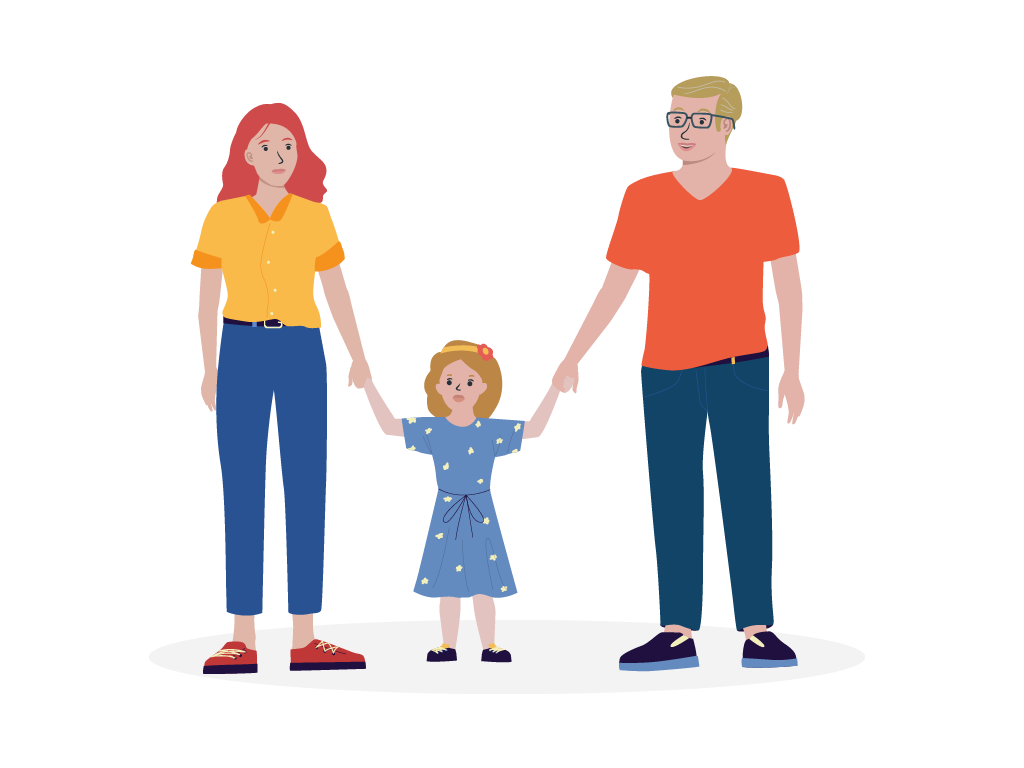
Beide Eltern betreuen das Kind
Weniger Einschränkungen bei der Erwerbstätigkeit
Betreuungsunterhalt kann stets nur derjenige Elternteil verlangen, der sich aufgrund der Kindesbetreuung und der dadurch eingeschränkten Erwerbstätigkeit finanziell nicht selbst versorgen kann. Wenn sich die Eltern die Betreuung des Kindes teilen, bestehen weniger berufliche Einschränkungen. Jeder Elternteil ist daher bei einer geteilten Betreuung schon während der ersten drei Lebensjahren des Kindes zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit angehalten, da eine teilweise Entlastung durch die Mitbetreuung des anderen Elternteils besteht. Im Einzelfall ist zu entscheiden, in welchem Umfang eine Erwerbstätigkeit zusätzlich zur Kindesbetreuung zumutbar ist. Dies ist vor allem auch vom Umfang des Mitbetreuungsanteils des anderen Elternteils abhängig.
Möglicher Anspruch auf Betreuungsunterhalt im Wechselmodell
Kann sich ein Elternteil trotz der geteilten Betreuung des Kindes finanziell nicht (vollständig) selbst versorgen und seine Erwerbstätigkeit aufgrund der Mitbetreuung des Kindes auch nicht weiter ausbauen, kann den anderen Elternteil auch im Wechselmodell eine Pflicht zur Zahlung von Betreuungsunterhalt treffen. Es kann dabei immer nur der wirtschaftlich schwächer gestellte Elternteil unterhaltsberechtigt sein; gegenseitige Unterhaltspflichten bestehen nicht.
Quellen & Links
Mehr zum Thema
Hier finden Sie Informationen zu Quellen der Inhalte dieser Seite und Links zu vertiefenden Informationen.
Quellen
Als Quellen wurden unter anderem verwendet:
Gernhuber, J., Coester-Waltjen, D. (2020). Familienrecht. C.H.Beck.
Schäuble, M. (2013). Erwerbsobliegenheit im Betreuungsunterhalt. H. Gietl Verlag.
Wendl, P., Dose, H.-J. (2019). Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis. Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und die Leitlinien der Oberlandesgerichte zum Unterhaltsrecht und zum Verfahren in Unterhaltssachen. C.H.Beck.
Wichtige Gerichtsentscheidungen:
BGH 10.6.2015 – XII ZB 251/14 (Verlängerung des Betreuungsunterhalts für Mutter eines behinderten Kindes)
BGH 18.4.2012 – XII ZR 65/10 (Verlängerung des Betreuungsunterhalts aus elternbezogenen Gründen)
BGH 15.6.2011 – XII ZR 94/09 (Kein Altersphasenmodell bei Entscheidung über Unterhalt für Betreuung älterer Kinder)
Weitere Informationen
Links zum Thema:
Broschüre des Bundesministeriums der Justiz zum Eherecht mit weiterführenden Informationen zu Trennung und Scheidung (Stand: 2024)
Familienportal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit FAQs zum Unterhaltsrecht
Broschüre des Bundesamtes für Justiz zur Geltendmachung von Unterhalt mit Auslandsbezug im In- und Ausland (Stand: 2021)
Die Düsseldorfer Tabelle enthält die einheitlichen Entscheidungsgrundsätze der Oberlandesgerichte in Unterhaltssachen. In den Leitlinien zur Düsseldorfer Tabelle finden sich die Grundlagen zur Ermittlung des unterhaltsrelevanten Einkommens. Andere Oberlandesgerichte verwenden ähnliche Leitlinien, die Sie über die Übersicht der FamRZ aufrufen können.
Kindesunterhalt
Kindesunterhalt hat Vorrang
Der Kindesunterhalt ist immer vorrangig zu berechnen. Der zu zahlende Kindesunterhalt wird bei der Berechnung des Betreuungsunterhalts berücksichtigt. Mehr zum Kindesunterhalt erfahren Sie auf folgender Unterseite.
Ehegattenunterhalt
Betreuungsunterhalt ist Teil des nachehelichen Unterhalts
Der Unterhalt des betreuenden Elternteils ist bei geschiedenen Eltern ein Teil des nachehelichen Unterhalts. Die Ausführungen zum nachehelichen Unterhalt finden daher bei geschiedenen Eltern auch Anwendung beim Betreuungsunterhalt.
Staatliche Unterstützung
Weitere finanzielle Stützen für Alleinerziehende
Alleinerziehende, die häufig einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt haben, können unter Umständen zusätzlich auf staatliche Unterstützung zurückgreifen. Welche staatlichen Leistungen in Betracht kommen, zeigt die folgende Unterseite.


